KUNSTSTILE
Romanik. 1000
-1250.

Abb.1
Der Begriff Romanik beschreibt eine
kunstgeschichtliche Epoche von etwa 1000
bis 1200, vielerorts werden
jedoch romanische Stilprinzipien bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts
beibehalten. Die romanische Kunst ist überall in Europa sowie in Westasien und Nordafrika nachzuweisen.
Stilprinzipien. Typisch für die romanische Baukunst sind
Rundbögen, dicke, festungsartige Mauern (besonders im Westwerk) mit kleinen
Fenstern sowie Würfelkapitelle
an den Säulen. In frühromanischer Zeit finden sich flache
Kassettendecken, später dann Kreuzgratgewölbe.
Der romanische Kirchenbau wird bestimmt durch die Einführung der
Überwölbung großer Raumweiten. Die Skulpturen und Malereien
zeigen oftmals drastische Motive.
Herkunft des Begriffs. Die Bezeichnung romanesque wurde um 1820 von französischen Gelehrten
für den Rundbogenstil eingeführt. Der Begriff wurde gewählt
unter Hinweis auf die Verwandtschaft zur römischen Architektur, von der
Rundbogen, Pfeiler, Säule und Gewölbebau übernommen waren. Also,
dieser Stil lehnte sich an die antike Kunst an.
Die Romanik in Deutschland lässt sich in
3 Stilphasen: Früh-, Hoch- und Spätromanik
einteilen. Im Allgemeinen ist Romanik durch starke, rohe Mauern, Rundbogen an
Fenstern und Turen, in der Malerei kräftige Grundfarben gekennzeichnet. Frühromanik (1024–1080) Die vorhandenen ökonomischen
und technischen Voraussetzungen sowie weltweite Anregungen ermöglichten
enorme Leistungen in der Baukunst. Die größte Kirche war die Abtei
von Cluny. Die
größte Kirche der salischen Kaiser war der Dom zu Speyer, der
Höhepunkt der Frühromanik; der Dom diente zugleich als Grablege der
Kaiser. Sie bestand aus einem Mittelschiffgewölbe, aus der ältesten
durchgehend mit Kreuzgewölbe überdeckten Basilika und aus der
größten Krypta. Hochromanik
(1080-1190) In der Hochromanik spielte
Bauschmuck eine große Rolle. Hinzu kamen mehr und mehr freistehende
figürliche Bildwerke, die oft aus Holz (Triumphkreuze, Madonnenfiguren, Lettnerfiguren), aber auch
aus Bronze (Braunschweiger
Löwe, Wolframleuchter in Erfurt)
gearbeitet wurden. Italienische Einflüsse sind wahrscheinlich, so
zunächst wohl bei der Quedlinburger
Stiftskirche mit ihrem vielfältigen bauplastischen Schmuck.
Kennzeichen der Hochromanik ist auch die Einführung des
Großgewölbebaus. Spätromanik
(1190–1235) Jede kleine Stadt besaß
Kirchen mit kreuzförmigen, dreischiffigen Basiliken. Die Spätromanik
zeichnet die Vielseitigkeit von Baukörpern und Innenräumen aus, die
mit Zierfreude und den Einzelheiten gebaut wurden. Doppelturmfassaden
entwickelten sich meist in Verbindung mit prächtig ausgebildeten
Vierungstürmen weiter. Viereckige Turme konnen oben achteckig fortgesetzt
werden.

Abb.2
Gotik. 1130 – 1500.

Abb.3
Der Begriff. Der Name "Gotik" wurde erst in der
Renaissance von dem italienischen Baumeister, Maler und Kunstschriftsteller
Giorgio Vasari (1511 bis 1574)
geprägt und hatte zunächst eine abwertende Bedeutung. Das Gotische
wurde mit dem Barbarischen gleichgesetzt im Gegensatz zur klassischen antiken
Kunst, der man den höchsten Stellenwert einräumte. Die
"barbarischen (West-Goten" hatten nach Auffassung Vasaris das
Römische Reich gestürzt. Und noch bis zum Jahr 1800 galt die Gotik
als Inbegriff schlechten Stils. Heute spielt der Begriff hauptsächlich in
der Architektur eine große Rolle, denn die bedeutendsten Sakralbauten
wurden in der Gotik errichtet. Doch auch in der Tafel-, Wand-, Glas- und
Buchmalerei, Plastik, Holzschnitz- und Goldschmiedekunst,
Musik, Schrift, Sprache, Mode und bei den
Möbeln haben sich gotische Stilmerkmale ausgeprägt, oder nahmen
begrifflichen Bezug.
Entwicklung. Der Übergang zwischen Romanik (750-1250) und Gotik (1130-1500)
vollzog sich - wie schon die zeitlichen Zuordnungen verraten - fließend.
Die Gotik entstand um
Baukunst. Während die
Kirchengebäude der Romanik breiter, erdgebundener und mit Rundbögen
konzipiert wurden, sind für die Sakralbauten der Gotik die mächtige
Raumhöhe und spitz zulaufende Bögen charakteristisch. Der Rundbogen
wird vom Spitzbogen abgelöst. Die ehemals geschlossenen Wände als
Schutz gegen das " Böse" von außen, werden in der Gotik
durch Fensterreihen durchbrochen. Es werden Helligkeit und eine
großzügigere Raumaufteilung angestrebt. Der Raum ist hoch senkrecht
gegliedert.Dazu werden Verzierungen durch Dienste, Rippen, Strebewerke,
Maßwerk, Wimperge und Fensterrosen einbezogen. Der Chorraum wird als
wichtiges kultisches Zentrum entdeckt und aufgewertet. Ein dreiteiliger
Laufgang, das Triforium durchbricht oft die Wand zwischen Bogenstellungen und
Fenstern. Außen wird die Westschauseite durch reiche Gliederung und
mächtig emporstrebende Türme betont. In der Früh- und Hochgotik
wurde der Raum in Höhe und Tiefe so gegliedert, daß der Besucher die
einzelnen Abschnitte nacheinander entdeckt (Basilika) In der Spätgotik
gestaltete man den Raum als ruhende Einheit, die von jedem Standpunkt aus
erfaßt werden konnte (Hallenkirche).

Abb.4
Religiöser Hintergrund. Die gotische Bauweise ist
jedoch nicht nur aus rein architektonischen Überlegungen entstanden.
Dahinter steht religiöse Symbolik. Die Säulen und Pfeiler entsprechen
den Aposteln und Propheten, die den christlichen Glauben tragen, Jesus ist der
Schlußstein, der eine Mauer mit der anderen verbindet.
Gotische Plastik/ Gotische Skulptur. Die gotische Plastik
entsteht zunächst aus dem Wunsch die Fassaden der Kathedralen mit
Standbildern, Reliefs und Figuren zu schmücken, die die Heilsgeschichte
symbolisieren. Besonders ausdrucksstark - innen wie außen - wurde das
Gewand gestaltet, welches mehr Aufschluß über die dargestellte Figur
gibt, als der Körper. Mit einer ungezwungenen Eleganz und mit einem weich
fließenden Gewand wird die Haltung der Personen in einer leichten S-Kurve
dargestellt. Dieses Bewegungsmotiv bleibt lange typisch für die gotische
Plastik. Die Spätgotik brachte in Deutschland eine Vielzahl an
Holzbildwerken für Flügelaltäre hervor. Seine berühmtesten
Schöpfer waren Tilman Riemenschneider (um 1460 bis 1531) und Syrlin d. J. (um 1455 bis 1521).
Gotische Malerei . Während in der Romanik die Kirchenwände noch
überreich mit Fresken bemalt waren, gestatten die spärlichen
Überreste des lichtdurchfluteten gotischen Kirchenraumes dies nicht mehr.
Es beginnt zunächst eine Ära der Glas- und Altarmalerei. In der 2.
Hälfte des 14. Jhs. setzten sich die Tafelbilder endgültig durch.
Gleichzeitig entstanden der Holz- und der Kupferstich. Stilistisch folgt die
gotische Malerei noch lange der byzantinischen Bildkunst, in der die Personen
maskenhaft, bewegungslos und entrückt den religiösen
Überzeugungen zufolge dargestellt sind.
Renaissance.
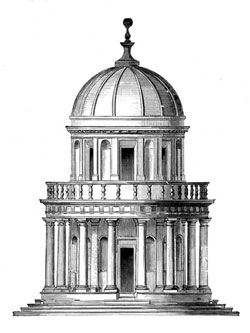
Abb.5
Grob kann man sagen: In Italien wird
die Zeit etwa von 1420 bis 1600 als Renaissance bezeichnet, im
übrigen Europa etwa die Zeit von 1500 bis 1600.
Das
französische Wort Renaissance bedeutet
"Wiedergeburt". Der Begriff wurde um 1820/30 von den Franzosen
zunächst aus dem italienischen rinascimento abgeleitet und dann
im deutschsprachigen Schrifttum um 1840 aus dem Französischen entlehnt, um
eine kulturgeschichtliche Epoche
Europas während des Übergangs
vom Mittelalter zur Neuzeit zu benennen.
Die
Epoche der Renaissance wird deshalb so bezeichnet, weil die Wiedergeburt der Antike eines der Ideale jener Zeit war. Diese Wiedergeburt
des antiken Geistes schlug sich besonders in den Künsten und ihren neuen,
als fortschrittlich empfundenen Prinzipien nieder. Der Humanismus ist die wesentliche
Geistesbewegung der Zeit. Diese "Wiedergeburt" manifestierte sich
darin, dass zahlreiche Elemente des Gedankenguts der Antike neu entdeckt und belebt wurden
(Schriften, Baudenkmäler, Skulpturen,
Philosophen, etc.).
Eine Voraussetzung für die neue
Geisteshaltung der Renaissance waren die Gedanken selbstbewusster italienischer
Dichter des 14. Jahrhunderts wie Francesco Petrarca, der
durch seinen Individualismus den Glauben an den Wert humanistischer Bildung
förderte. Das theozentrische
Weltbild des Mittelalters wurde durch eine stärker anthropozentrische Sicht
der Dinge abgelöst.
Nicht
zu vernachlässigen ist auch der Einfluss von Griechisch sprechenden
Gelehrten, die im 13. und 14. Jahrhundert aus Byzanz nach Italien kamen und das Wissen
über die Kultur der Antike mitbrachten, das im Byzantinischen Reich nach
dem Untergang Westroms nahezu 1000 Jahre
lang konserviert worden war. In Byzanz
waren noch im Jahre 1400 Platon,
Homer und Herodot in aller Munde.
Im
weiteren Sinne nennt man Renaissance daher die Wiedergeburt des klassischen Altertums
in seinem Einfluss auf die Wissenschaft,
die Literatur, die Gesellschaft,
das Leben der vornehmen Kreise und die Entwicklung der Menschen zu
individueller Freiheit im Gegensatz zum Ständewesen des Mittelalters. Im
engeren Sinne versteht man unter der Renaissance eine
kunstgeschichtliche Epoche.Die italienische Bezeichnung rinascita im
Sinne eines Epochenbegriffs findet sich bereits bei Giorgio Vasari, der eine
der wichtigsten Lebensbeschreibungen von Renaissance-Künstlern verfasst
hat.
In der Kunst lehnte sich die Renaissance der
Antike an. Zur Nachahmung der antiken
Kunst gesellte sich im 15. Jahrhundert die intensivere Beschäftigung mit
der Natur, die einen wichtigen Aspekt in der
Entwicklungsgeschichte der Renaissancekunst darstellt. Die Tendenz,
Gegenstände und Personen der Natur gemäß zu gestalten, war
seitdem ein Hauptanliegen der Künstler.
In nahezu perfekter Ausprägung gelang ihnen eine solche naturalistische
Darstellungsweise allerdings erst seit dem 15. Jahrhundert. Eng mit der
Forderung nach der Naturwahrheit in der Kunst hängt das Bekenntnis der
Künstler zur Antike zusammen. Das heißt: Gute Kunst sollte das, was
einem die Realität bietet, nicht getreu abbilden, sondern versuchen, das
Naturvorbild zu verbessern und zu idealisieren.
Neben
der Neubestimmung des Verhältnisses der Kunst zur Natur und der Verehrung
der Antike stellte die Renaissance also auch die Frage nach dem Wesen der Schönheit. Die
Künstler versuchen z.B., den idealschönen Menschen darzustellen.
Anatomische Vorstudien dienen dazu, den menschlichen Körper
wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Ideale Maße und Proportionen spielen sowohl bei der
Darstellung des menschlichen Körpers in der Malerei und Skulptur als auch bei der Konzipierung von
Gebäuden eine Rolle (Zentralperspektive, Luft- und Farbeperspektive,
Symmetrie, harmonische Ausgewogenheit, Goldener Schnitt).

Abb.6
Die Tendenz in der Baukunst besteht darin, die Formensprache der
Antike in voller Strenge wieder zu beleben. Italienische Renaissancebauten
wurden klar, überschaubar und harmonisch ausgewogen konzipiert. Die
Architekten orientierten sich bei den Grundrissen an einfachen idealen
geometrischen Formen wie dem Quadrat
oder dem Kreis. Man entlehnt
Bauelemente wie Säulen,
Pilaster, Kapitelle, Dreiecksgiebel
etc. direkt der Antike, um daraus Anhaltspunkte für idealschöne
Proportionen zu gewinnen. Die Hauptstilkriterien sind: akademisch korrekte
Säulenordnungen; Betonung der Horizontalen (waagerechten Linien);
Säulenschäfte nach dem Vorbild der Antike entweder kanneliert oder
glatt; Arkaden statt Kolonnaden;
Grundrisse und Fassaden mit Rücksicht auf Symmetrie und
Regelmäßigkeit gestaltet.

Abb.7
Der
Begriff Barock (von ital. barocco = "schiefrund,
merkwürdig" und franz. baroque = "Auswucherung,
Warze", bedeutet auch unregelmäßig Perle) bezeichnet die
kunstgeschichtliche Stilepoche,
die der Renaissance folgte. Diese
Einteilung gilt für die Baukunst,
die bildende Kunst und
für die Musik, wobei die
Epochengrenzen in den unterschiedlichen Gattungen oft etwas abweichend gesetzt
werden. Barock wird auch als Zeitalter der Theatralik und Inszenierung
bezeichnet.
Baukunst und Landschaftsarchitektur. In der barocken Baukunst wurde das Ganze des Bauwerkes
nicht mehr durch Summation von Einzelteilen verstanden, also vom Teil zum
Ganzen, sondern umgekehrt als einen ausdifferenzierten Organismus vom Ganzen
zum Teil. Weitere wichtige Merkmale der barocken Baukunst sind: Ablösung
schmaler, langer Kirchenschiffe durch breitere, bisweilen runde Formen;
Dramaturgischer Gebrauch des Lichtes entweder durch starke
Hell/Dunkel-Kontraste oder einheitliche Durchflutung durch zahlreiche Fenster;
Häufiger Gebrauch von plastischen Zierelementen (Girlanden,
Putten aus (oft vergoldetem) Holz, Schweifwerk,
Kartuschen, Gips bzw. Stuck, Marmor
oder Stuckmarmor);Großflächige
Deckengemälde; üppige geschwungene Linien. Die Außenfassade ist
häufig durch eine dramatische Steigerung zur Mitte charakterisiert; Das
Innere ist oft nur Schale für die dekorative Ausschmückung durch
Malerei und Plastik (vor allem im Spätbarock); Häufiger Gebrauch von
illusionistischen Effekten wie Scheinarchitektur
oder Verschmelzung von Malerei
und Architektur; Im bayrischen und schwäbischen Barock sind Zwiebeltürme
sehr verbreitet.

Abb.8
Barocke Malerei. War die Malerei der Hochrenaissance um harmonische,
ausgewogene und formstrenge Komposition bemüht, geriet in der
Spätrenaissance bzw. im Manierismus
dieses Gleichgewicht aus den Fugen. So kam es in der Barockmalerei im gewissen
Sinne zu einer Synthese von Manierismus und Hochrenaissance. Mit dem
Manierismus widmete sich die Malerei zum ersten Mal explizit dem Unausgewogenen
und Bizarren. Kennzeichen dessen sind die sog. "figurae
serpentinatae". Sie thematisieren menschliche Affekte. Die Barockmalerei
ließ nun diese tiefen menschlichen Affekte nicht unvermittelt stehen,
sondern bemühte sich darum, sie zu einer Gesamtaussage zur höchsten
Dramaturgie zu verdichten. Damit wurde nun in gewisser Weise wieder dem
Harmoniebedürfnis der Hochrenaissance entsprochen. In der barocken Malerei
herrschen dementsprechend dynamische Bildwelten vor, die für
religiöse Themen ebenso wie für weltliche, mythologische oder
Landschaftsdarstellungen verwendet werden.
Die
kunstgeschichtliche Epoche des Barock
fand eine Weiterentwicklung im Rokoko. Stiltypisch sind
überbordende Verzierungen, leichte, schwungvolle, fast spielerische,
zierliche Formen.
Schmuckelemente: buntes, künstlerisches Schmuckwerk, Ornamente in
Muschelform und Rosenranken, feine Schnitzereien - an Bauten, Innenräumen,
Möbeln, Geräten etc. und vor allem die Aufgabe jeglicher Symmetrie,
die im Barock noch als wichtiges
Element verwendet wurde. An die Stelle fester Formen treten leichte, zierlich
gewundene Linien und häufig rankenförmige Umrandungen. Die Rocaille (franz.: Muschelwerk)
soll namensgebend für diese Kunstrichtung gewesen sein. (Diese bewusste
Abkehr von Symmetrie wurde später im Jugendstil wieder aufgegriffen.)
Klassizismus.

Abb.9
Der
Begriff Klassizismus wird verwendet für Kunstrichtungen (Literatur, Baukunst, Bildhauerei, Malerei etc.), die nicht eigenständig
aus eigenen Anfängen gereift sind, sondern Nachahmungen einer Klassik
sind, z.B. Nachahmungen des klassischen Altertums. Die Anlehnung an die Antike
setzt sich wieder aber auf einer neuen Ebene durch.Hauptsächlich aber wird
als Klassizismus eine Epoche der gesamten Kunstgeschichte im
späten 18.
und frühen 19. Jahrhundert
(etwa zwischen 1770 und 1830) bezeichnet, die die griechische Klassik zu erneuern versuchte. In Frankreich heißt diese Epoche Empire-Stil. Im späten 18. Jahrhundert galt der
Klassizismus mit fast puritanischen Willen zur Vereinfachung als Gegenmodell
zur barocken "Verschwendungssucht", die mit dem Feudalismus assoziiert wurde. Mit der
Vereinnahmung der Revolution durch Napoleon kommt es dann zum
dekorativeren Empirestil, der sich mit dem Kaiser über ganz
Westeuropa ausbreitet.
Merkmale. Gegenüber dem vorangegangenen Rokoko zeichnet sich der Klassizismus
durch eine Rückkehr zu geradlinigen Formen mit einer stärkeren
Anlehnung an klassisch-antike Formen aus. Charakteristiken: rechteckige,
gerade, einfache Formen; Basreliefs als Schmuck; weiße strenge
Säulen auf der dezent gelb gestrichenen oder steingrauen Fassade; allgemeiner Eindruck von der
erhabenen, edlen, majestätischer Ruhe und dem feinen strengen Geschmack.
Beispiele in Sankt- Petersburg: die Admiralität, die Rossi-Straße,
das Alexandrinski- Theater, das Schloss in Gatschina.

Abb.10
In der
Mitte des 20. Jahrhunderts
lehnte sich die Architektur teilweise wieder an klassizistische Formen an, man
spricht hier von Neoklassizismus.
Jugendstil
ist eine kunsthistorische Epoche um die Jahrhundertwende des 19. zum
20. Jahrhundert.

Abb.11
Der
Begriff ist nur in Deutschland
(den Niederlanden und in Lettland) in Gebrauch, so benannt nach der 1896 gegründeten Münchner
illustrierten Kulturzeitschrift Die Jugend.
Die dem Jugendstil entsprechenden Stilrichtungen werden in anderen Ländern
bzw. Sprachen als Art Nouveau oder Belle Epoque,
Modern Style,Modernismo, Stile Liberty oder Wiener Secession
bezeichnet.
Die Elemente sind dekorativ geschwungene
Linien sowie flächenhafte florale Ornamente
und die Aufgabe jeglicher Symmetrien. Die Linien sehen rund und rechteckig zu gleicher Zeit
aus. Es geht um die künstlerische Neugestaltung aller alltäglichen
Dinge. In der Baukunst bedeutet es die Abkehr von historischen Bauformen und
die intensive Suche nach neuen dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten: nicht
symmetrische Fassaden, Fenster von verschiedenen Umrissen, stilisierte
Pflanzenornamente. Besonders
ausgeprägt findet man den Jugendstil auch im Kunsthandwerk, im damals sogenannten
'Kunstgewerbe', und der Architektur. Verwandte Strömungen gab es in
Malerei, Grafik, Buchkunst, Mode, Schmuck, Bildhauerei, Dichtung, Musik,
Theater und Tanzkunst. Das Berliner Bröhan-Museum zeigt
Möbel, Porzellan, Glas, Keramik und Metallarbeiten aus der Epoche des
Jugendstils und des Art Deco. Mit dem Jugendstil verbinden sich zahlreiche
künstlerische Programme und Manifeste. Er steht für ganzheitliche
harmonisierende Gesamtkunstwerke
und die darin gesuchte Einheit von 'Kunst und Leben'.

Abb.12
Übungen zum
Wortschatz.
Aufgabe 1. Wiederholen Sie die Verben aus dem
Text, die nicht nur zum Thema „Kunst“ gehören, sondern allgemein
gültig sind. Füllen Sie die
Lücken aus.
Romanik.
Der Begriff Romanik ________________ eine
kunstgeschichtliche Epoche von etwa 1000
bis 1200.
Die romanische Kunst ist
überall in Europa
sowie in Westasien
und Nordafrika
________________.
_______________ für
die romanische Baukunst
sind Rundbögen.
Der romanische Kirchenbau wird durch die
Einführung der Überwölbung __________________.
Die Bezeichnung romanesque
wurde um 1820 von französischen
Gelehrten __________________. Dieser Stil ______________sich an die antike
Kunst ____.
Die Romanik in Deutschland lässt sich in
3 Stilphasen _________________.
Im Allgemeinen
ist Romanik durch starke, rohe Mauern _______________________.
______________________der
Hochromanik ist auch die Einführung des Großgewölbebaus. Doppelturmfassaden
____________________ meist in Verbindung mit prächtig ausgebildeten
Vierungstürmen weiter.
Gotik.
Der
Name "Gotik" wurde von Giorgio Vasari _________________und hatte
zunächst eine ______________Bedeutung.
Und
noch bis zum Jahr 1800 _____________die Gotik als Inbegriff schlechten Stils.
Der
Übergang zwischen Romanik
(750-1250) und Gotik (1130-1500) ____________________fließend.
Die Gotik entstand um
Im 15.
Jahrhundert ___________die Renaissance (1420-1620) zunächst in Italien die
Gotik _____.
Es
werden Helligkeit und eine großzügigere Raumaufteilung ________________.
Der
Raum ist hoch senkrecht______________.
Außen
wird die Westschauseite durch reiche Gliederung und mächtig emporstrebende
Türme _______________.
Die
Basilika ist so gegliedert, dass der
Besucher die einzelnen Abschnitte nacheinander _______________.
Renaissance.
Der
Begriff wurde von den Franzosen aus dem italienischen rinascimento
_______________.
Die
Wiedergeburt der Antiken ______________ ________besonders in den neuen Prinzipien
_______.
Im
weiteren Sinne nennt man Renaissance die Wiedergeburt des klassischen Altertums
in seinem _____________auf die Wissenschaft,
die Literatur, die Gesellschaft.
Beschäftigung
mit der Natur______________ einen
wichtigen Aspekt der Renaissancekunst _________. Anatomische Vorstudien dienen
dazu, den menschlichen Körper wirklichkeitsgetreu _________________.
Italienische
Renaissancebauten wurden klar, überschaubar und harmonisch ausgewogen
________________. Die Architekten ___________________ bei den Grundrissen an
einfachen idealen geometrischen Formen.
Man entlehnt Bauelemente
der Antike, um daraus Anhaltspunkte für ideale Proportionen zu
_____________.
Barock.
Der
Begriff Barock bezeichnet die Stilepoche,
die der Renaissance _____________.
In der
barocken Baukunst wurde das Ganze nicht mehr durch Summation von Einzelteilen
_______________. Wichtiges Merkmal der barocken Baukunst sind: _______________
schmaler, langer Kirchenschiffe durch breitere
runde Formen.
Ein
Merkmal ist auch ___________________ von Malerei
und Architektur.
In der barocken Malerei
herrschen dynamische Bildwelten vor, die für religiöse Themen ____________
werden.
Klassizismus.
Die ________________an
die Antike setzt sich wieder aber auf einer neuen Ebene durch.
Der
Klassizismus _______________ _______durch
eine Rückkehr zu geradlinigen Formen _________.
Jugendstil.
Der
Begriff ist nur in Deutschland
(den Niederlanden und in Lettland) in _____________.
Besonders
________________ findet man den Jugendstil auch im Kunsthandwerk. Mit dem Jugendstil
_________________zahlreiche künstlerische Programme und Manifeste.
Aufgabe 2. Ordnen
Sie die unten stehenden Merkmale den Stilen zu.
|
Rundbögen Ideale
Maße und Proportionen
Der
Raum ist hoch senkrecht gegliedert. Triforium Würfelkapitelle
an den Säulen flache Kassettendecken Luft-
und Farbeperspektive Überwölbung
großer Raumweiten drastische Motive die
intensivere Beschäftigung mit der Natur Verwandtschaft zur
römischen Architektur mächtige
Raumhöhe Bauschmuck
figürliche
Holzbildwerke Fresken Doppelturmfassaden
mit Vierungstürmen großzügige
Raumaufteilung Fenster
von verschiedenen Umrissen Verzierungen
durch Dienste, Rippen, Strebewerke starke, rohe Mauern Wimperge
Chorraum
als kultisches Zentrum dreiteiliger
Laufgang Großflächige Deckengemälde Bogenstellungen
reiche
Gliederung mächtig
emporstrebende Türme Außenfassade
mit dramatischer Steigerung zur Mitte Schmuck
mit Standbildern, Reliefs und Figuren die
Haltung der Personen in einer S-Kurve lichtdurchfluteter Kirchenraum Glas-
und Altarmalerei Tafelbilder Holz- und der Kupferstich Maskenhafte,
bewegungslose Darstellung dicke, festungsartige
Mauern mit kleinen Fenstern anthropozentrische Sicht
der Dinge naturalistische
Darstellungsweise Fensterrosen
Fensterreihen
Helligkeit
Maßwerk Naturvorbild verbessern und idealisieren Zentralperspektive spitz
zulaufende Bögen Symmetrie harmonische Ausgewogenheit Die
Säulen und Pfeiler entsprechen den Aposteln und Propheten plastische
Zierelemente (Girlanden) Goldener Schnitt überschaubar und
harmonisch ausgewogen Grundrisse an
einfachen idealen geometrischen Formen illusionistische
Effekte wie Scheinarchitektur
Antike Säulen, Pilaster, Kapitelle, Dreiecksgiebel
akademisch korrekte Säulenordnungen Betonung der
Horizontalen Säulenschäfte entweder kanneliert oder glatt Arkaden statt Kolonnaden Putten aus (oft vergoldetem) Holz Fassaden mit
Rücksicht auf Symmetrie und Regelmäßigkeit Organismus
vom Ganzen zum Teil breitere,
runde Formen Dramaturgischer Gebrauch des Lichtes starke Hell/Dunkel-Kontraste einheitliche
Durchflutung durch zahlreiche Fenster künstlerische
Neugestaltung alltäglicher Dinge das
Bekenntnis der Künstler zur Antike Marmor oder Stuckmarmor üppige
geschwungene Linien Linien rund und rechteckig zu gleicher Zeit dekorative
Ausschmückung durch Malerei und Plastik Verschmelzung von Malerei und Architektur Synthese von Manierismus
und Hochrenaissance Unausgewogenes und Bizarres dynamische Bildwelten überbordende
Verzierungen leichte, schwungvolle, fast spielerische,
zierliche Formen buntes, künstlerisches Schmuckwerk in
Symmetrie Pflanzenmotive feine Schnitzereien Gegenmodell
zur barocken "Verschwendungssucht Rückkehr
zu geradlinigen Formen mit einer stärkeren Anlehnung an klassisch-antike
Formen rechteckige, gerade, einfache Formen stilisierte
Pflanzenornamente weiße strenge Säulen auf der
dezent gelb gestrichenen oder steingrauen
Fassade erhabene, edle, majestätische Ruhe strenger Geschmack dekorativ
geschwungene Linien flächenhafte
florale Ornamente Aufgabe
jeglicher Symmetrien Basreliefs
als Schmuck Suche
nach neuen dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten Individualismus
nicht
symmetrische Fassaden Rundbogen
an Fenstern und Türen Anatomische
Vorstudien Handwerk, Einheit von 'Kunst und Leben' |
Jugendstil |
|
Klassizismus |
|
|
Barock |
|
|
Romanik |
|
|
Gotik |
|
|
Renaissamce |